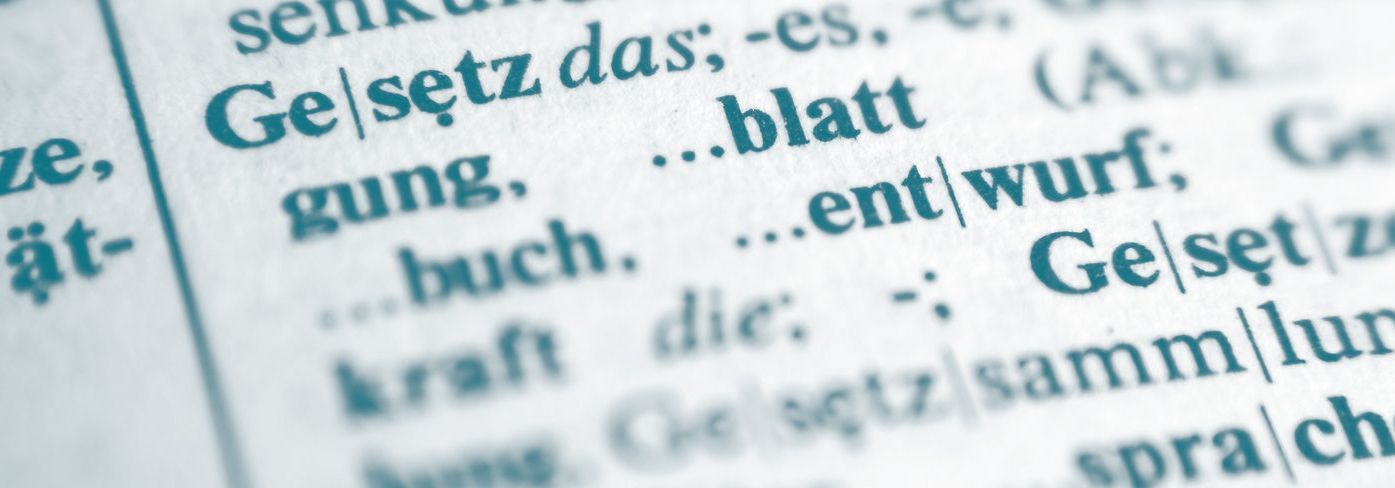
Neue Gesetze im Landtag
GESETZESINFORMATIONSDIENST
Juni 2024
Thüringer Gesetz über die Stärkung der Demokratie durch Herstellung von umfassender Transparenz in der Politik (Drucksache 7/10211)
Landtag führt Lobbyregister ein und verschärft Transparenzregeln für Abgeordnete
Der Landtag führt ein sogenanntes Lobbyregister ein, das die bereits bestehende Beteiligtentransparenzdokumentation (BTD) ergänzen soll. Zugleich verschärft er die Regeln, nach denen Abgeordnete unter anderem Auskünfte über ihre Tätigkeiten vor und während ihrer Landtagsmitgliedschaft und daraus erzielte Einkünfte sowie Parteispenden und Spender geben müssen. Dazu hat das Landesparlament in seiner letzten regulären Sitzung der 7. Wahlperiode ein Thüringer Beteiligungsdokumentations- und Lobbyregistergesetz (ThürBetdokLobregG) erlassen und das Thüringer Abgeordnetengesetz geändert.
Bereits seit 2019 betreibt der Landtag eine BTD, in der dokumentiert wird, wer auf Gesetzgebungsverfahren des Landtags Einfluss nimmt. Für diese Form der Dokumentation ist der Begriff des „legislativen Fußabdrucks“ gebräuchlich. Die rechtliche Grundlage der BTD, das Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz, wird nun ohne wesentliche Änderungen in das neue ThürBetdokLobregG integriert und um ein öffentliches Verzeichnis der Interessenvertretung, das Lobbyregister, ergänzt.
Dort muss sich jeder registrieren, der unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf die Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse des Landtags und der Landesregierung nimmt. Das Gesetz bildet mögliche Formen und Adressaten der Einflussnahme detailliert ab, regelt den Umfang der Registrierungspflicht, Ausnahmen sowie Sanktionen für den Fall, dass Lobbyisten ihren entsprechenden Pflichten nicht nachkommen.
Strengere Transparenzregeln erlegen sich die Abgeordneten mit dem Gesetz auch selbst auf. So werden etwa die Bestimmungen für die Entgegennahme von Parteispenden und zu den Angaben über Einkünfte aus anzeigepflichtigen Tätigkeiten deutlich verschärft. Spenden für ihre eigene politische Arbeit dürfen sie gar nicht mehr annehmen. Detailliertere Auskunft müssen Abgeordnete künftig auch über ihre Tätigkeiten aus der Zeit vor einer Mitgliedschaft im Landtag geben.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes (Drucksache 7/9855)
Experimentierklausel im Bereich des E-Government bis zum Jahresende 2029 verlängert
Der Thüringer Landtag hat die Übergangsfrist für eine Experimentierklausel im Bereich des E-Government bis zum Jahresende 2029 verlängert. Mit der Experimentierklausel soll der elektronische Zugang zu solchen Verwaltungsleistungen schrittweise erleichtert werden können, die eine Schriftform voraussetzen. Zudem ermöglicht das Parlament den Kommunen eine interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich und es hat die Thüringer Landesmedienanstalt aus dem Anwendungsbereich des Thüringer E-Government-Gesetzes (ThürEGovG) herausgenommen.
Die Experimentierklausel des § 12 Abs. 2 ThürEGovG sieht vor, dass die zuständige Behörde mit Zustimmung der für sie zuständigen obersten Aufsichtsbehörde des Landes für den Zeitraum bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 weitere Formen der elektronischen Kommunikation zulassen kann, um eine vorgeschriebene Schriftform zu ersetzen. Diese Frist wird nun um drei Jahre verlängert, um Rechtssicherheit und Planbarkeit auf Seiten der zuständigen Behörden zu gewährleisten.
Der Landtag ermöglicht den Kommunen daneben, gemeinsame Rechenzentren auf Grundlage einer freiwilligen interkommunalen Zusammenarbeit zu nutzen. So wollen die Abgeordneten Problemen begegnen, die sich insbesondere aus der zunehmenden Komplexität der Informationstechnologie, dem hohen Grad der Vernetzung, der Abhängigkeit der Verwaltung von IT-gestützten Verfahren sowie den damit verbundenen steigenden Kosten und dem erheblichen Steuerungsaufwand ergeben. Sie legen dabei zugrunde, dass nicht alle Kommunen die Aufgaben mittel- bis langfristig umsetzen können.
Zuletzt sieht das Gesetz vor, die Thüringer Landesmedienanstalt aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes herauszunehmen, da es sich bei ihr um keine klassische Verwaltungsbehörde handelt und auch vergleichbare Institutionen dem Anwendungsbereich nicht unterfallen. So unterliegt die Thüringer Landesmedienanstalt nur einer eingeschränkten Rechtsaufsicht durch die Staatskanzlei und wird nicht durch Steuermittel, sondern durch den Rundfunkbeitrag finanziert. Sie hat keinen Zugriff auf das zentrale E-Government-Portal und ist auch nicht in die Digitalstrategie des Landes eingebunden.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes (Drucksache 7/9864)
Landtag erweitert Promotionsmöglichkeiten an Fachhochschulen
Das für Wissenschaft zuständige Ministerium kann Thüringens Fachhochschulen künftig ein fachlich begrenztes Promotionsrecht einräumen, vorausgesetzt sie sind ausreichend forschungsstark und richten ein entsprechendes Promotionszentrum ein. Das hat der Landtag beschlossen. Er erweitert damit die Promotionsmöglichkeiten an Fachhochschulen.
Bereits bisher waren sogenannte kooperative Promotionen möglich, bei denen Hochschullehrer einer Fachhochschule und Hochschule einen Doktoranden gemeinsam betreuten. Dieses Modell fand eine nur eingeschränkte Resonanz. Das fehlende Promotionsrecht erschwerte es Fachhochschulen weiterhin, Forschungsprojekte einzuwerben und forschungsstarke Professoren zu gewinnen.
Zukünftig können die Fachhochschulen allein oder in Kooperation mit anderen Hochschulen ein Promotionszentrum einrichten und für einzelne Fachbereiche ein Promotionsrecht beantragen. Es wird begutachtet, ob sie in diesem Bereich ausreichend forschungsstark sind, und das Promotionsrecht wird zunächst auch nur befristet verliehen. Nach einer erfolgreichen Evaluation kann das Recht entfristet werden.
Die Verleihung, Kriterien, Verfahren und Evaluation soll das Wissenschaftsministerium durch eine Rechtsverordnung regeln. Es hat dazu das Einvernehmen mit dem zuständigen Fachausschuss des Landtags herzustellen.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb von internen Meldestellen im kommunalen Bereich und zur Ergänzung der Regelungen zum Lagebericht bei Beteiligung der Kommunen an Unternehmen des privaten Rechts (Drucksache 7/9657)
Hinweisgeberrichtlinie nun auch für Gemeinden und Gemeindeverbände anwendbar
Die sogenannte Hinweisgeberrichtlinie der Europäischen Union (EU) ist nun auch für Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Beschäftigungsgeber anwendbar, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Gemeinden und Gemeindeverbänden stehen. Dies hat der Landtag beschlossen. Er nutzt dabei die für kleine Gemeinden und sonstige juristische Personen vorhandene Ausnahmeklausel.
Ziel der Hinweisgeberrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17)) ist es, Benachteiligungen von Hinweisgebern auszuschließen und ihnen Rechtssicherheit zu geben. Verboten sind u.a. die Suspendierung oder Entlassung, die Herabstufung oder Versagung einer Beförderung, die Diskriminierung, Nötigung oder Einschüchterung (Art. 19 der Richtlinie).
Die Richtlinie erlaubt es dabei in ihrem Art. 8 Abs. 9 UAbs. 3, Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern oder weniger als 50 Arbeitnehmern oder sonstige juristische Personen des öffentlichen Sektors mit weniger als 50 Arbeitnehmern von der Verpflichtung zur Einrichtung interner Meldekanäle auszunehmen. Von dieser Ausnahmeregelung macht der Gesetzgeber Gebrauch. Da das Gesetz gleichzeitig die Einrichtung einer externen Meldestelle des Landes vorsieht, können Hinweisgeber in einem solchen Fall beispielsweise diese externe Meldestelle nutzen. Weiterhin können interne Meldestellen gemeinsam oder von gemeinsamen Behördendiensten eingerichtet und betrieben werden.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zur landesrechtlichen Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes (Drucksache 7/9650)
Landesrechtliche Grundlagen für Wärmeplanung beschlossen
Die Thüringer Gemeinden werden für die Wärmeplanung in ihrem Gemeindegebiet zuständig. Aus der bisher freiwilligen Aufgabe im eigenen Wirkungskreis wird eine verpflichtende Aufgabe im sogenannten übertragenen Wirkungskreis, in dem die Kommunen vom Land übertragene Aufgaben nach dessen Vorgaben wahrnehmen. Das ist der wesentliche Inhalt des vom Landtag beschlossenen Thüringer Gesetzes zur landesrechtlichen Umsetzung des vom Bund erlassenen Wärmeplanungsgesetzes.
Das am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz des Bundes verpflichtet die Länder, für ihr Hoheitsgebiet sicherzustellen, das Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern bis Ende Juni 2026 eine Wärmeplanung vorlegen. Kleinere Kommunen müssen diese Aufgabe bis Ende Juni 2028 erledigt haben. Der Bundesgesetzgeber hat die Länder ermächtigt, konkrete Zuständigkeiten und Verfahren landesrechtlich zu regeln. Dieses Recht hat der Thüringer Landtag nun genutzt.
Die Wärmeplanung ist eine wesentliche Grundlage für energetische Maßnahmen, zu denen das Gebäudeenergiegesetz die Bürger verpflichtet. Die Gemeinden werden zur sogenannten planungsverantwortlichen Stelle, weil sie mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut sind. Für die Wärmeplanung entstehen zunächst bis 2028 voraussichtlich Kosten von rund 20 Millionen Euro.
Zugleich hat der Landtag das Thüringer Klimagesetz geändert. Es sah seit 2018 die Möglichkeit für Kommunen vor, auf freiwilliger Basis im eigenen Wirkungskreis Wärmeanalysen und darauf aufbauende Wärmekonzepte aufzustellen. Diese Möglichkeit hatte bis Ende 2023 jedoch keine Gemeinde genutzt.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Bauordnung (Drucksache 7/9641)
Thüringen erhält eine neue Bauordnung
Der Landtag hat die bisher geltende Thüringer Bauordnung (ThürBO) durch eine Neufassung abgelöst, da sich im Laufe der Zeit ein erheblicher Änderungsbedarf ergeben hat, der unter anderem auf europa- und bundesrechtliche Vorgaben zurückgeht.
Mit der neu gefassten ThürBO wird ein digitales Baugenehmigungsverfahren ermöglicht, bei dem die Schriftform auf das unbedingt Notwendige begrenzt wird. Die Novelle umfasst zudem zahlreiche Regelungen, die es Hausbesitzern ermöglichen sollen, die Energiewende mit Baumaßnahmen zu unterstützen. So sollen die nachträgliche Wärmedämmung oder die Errichtung von Solaranlagen auf Dächern von Doppel- und Reihenhäusern erleichtert werden.
Mit der Neufassung werden zudem die Anforderungen an barrierefreies Bauen ergänzt. Das Bauen im Bestand soll einfacher werden, insbesondere um die Inanspruchnahme neuer Flächen zu vermindern und kurzfristig zur Verfügung stehenden kostengünstigen Wohnraum zu schaffen.
Mit dem Ablösungsgesetz wird zudem eine grundsätzliche Pflicht eingeführt, Abstellplätze für Fahrräder zu schaffen. Bei der Zahl zu errichtender Kfz-Stellplätze werden künftig unter anderem kommunale Mobilitätskonzepte berücksichtigt.
Mobilfunkanlagen werden künftig in größerem Umfang als bisher verfahrensfrei gestellt, um den Ausbau der Mobilfunknetze zu unterstützen. Für diese und weitere genauer umrissene baugenehmigungspflichtige Anlagen soll in Zukunft das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ausreichen.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften im Jahr 2024 (Drucksache 7/9818)
Im Thüringer Verwaltungsverfahren gilt von 2025 an weitgehend das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes
Das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) verweist von 2025 an für die allermeisten Verwaltungsvorgänge auf das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) des Bundes, das dann unmittelbar anzuwenden ist. Der Landtag zieht damit die Konsequenzen aus der sogenannten Simultangesetzgebung von Bund und Ländern im Bereich der Verwaltungsverfahren und folgt dabei dem teils jahrzehntealten Beispiel mehrerer Länder. Die Neufassung des ThürVwVfG ist Teil eines vom Landtag beschlossenen Mantelgesetzes „zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften im Jahr 2024“, in dem insbesondere zahlreiche Folgeänderungen in weiteren Gesetzen aus dieser Grundentscheidung nachvollzogen werden und die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung vorangetrieben wird.
Das zurzeit noch 97 Paragraphen umfassende ThürVwVfG schrumpft damit auf ganze neun Paragraphen, in denen unter anderem Abweichungen in Einzelfragen geregelt werden. Vom VwVfG des Bundes kann der Landtag auch zukünftig abweichen, denn die Kompetenzaufteilung zwischen dem Bund und den Ländern verändert sich durch diesen vor allem aus praktischen Gründen beschrittenen Weg nicht. Der Schritt reduziert den Verwaltungsaufwand und den landesrechtlichen Gesetzgebungsbedarf deutlich und gewährleistet unkompliziert, dass die Verwaltungsverfahren im Bund, im Land, in den Kommunen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, die der Aufsicht des Landes unterstehen, im Wesentlichen nach gleichen Regeln und Verfahren ablaufen. Ändert der Bundesgesetzgeber das VwVfG, gilt das geänderte Recht auch in Thüringen.
Mit dem Mantelgesetz und seinen einzelnen Artikeln vollzieht der Landtag zudem und unter anderem Entwicklungen der vergangenen Jahre nach. Einen Schwerpunkt bilden Fragen der Digitalisierung der Verwaltung, etwa der Verzicht auf die schriftliche Form bei einzelnen Verwaltungsvorgängen, den Regelungen zum Einsatz elektronischer Signaturen oder die Nutzbarkeit des Identitätsnachweises via eID-Karte.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen und zahnärztlichen Versorgung in Gebieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Haus- und Zahnärztesicherstellungsgesetz – ThürHaZaSiG- Drucksachen 7/8549/10156)
Angebot: Medizinstudienplätze nach der Vorabquote gegen Verpflichtung zur Teilnahme an der haus- und zahnärztlichen Versorgung in unterversorgten Regionen
Der Landtag will die hausärztliche und zahnärztliche Versorgung auch in Regionen des Landes absichern, die unterversorgt sind oder in denen eine Unterversorgung droht. Dazu unterbreitet er Bewerbern um die begehrten Studienplätze ein Angebot: Wenn sie sich zu Ärzten ausbilden lassen, die zur hausärztlichen Versorgung zugelassen werden können, und anschließend mindestens zehn Jahre in entsprechenden Regionen arbeiten, können sie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena einen Studienplatz im Rahmen der sogenannten Vorabquote erhalten, die im Staatsvertrag über die Hochschulzulassung geregelt ist. Gleiches gilt für Bewerber um einen Zahnmedizinstudienplatz, die Vertragszahnärzte oder Kieferorthopäden werden wollen. Die Einzelheiten hat der Landtag im jetzt beschlossenen Thüringer Haus- und Zahnärztesicherstellungsgesetz geregelt.
Hintergrund des Gesetzes ist ein Beschluss des Landtags (Drucksache 7/1829) aus dem Jahr 2021, wonach künftig sechs Prozent der Studienplätze an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Rahmen der Vorabquote an Studenten vergeben werden sollen, die sich wie ausgeführt vertraglich binden. Der Landtag hat den von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf nun um Vertragszahnärzte und Kieferorthopäden erweitert.
Das Gesetz regelt insbesondere die Auswahl der Bewerber in einem zweistufigen Verfahren durch eine fachkundige Auswahlkommission. Geprüft werden die fachliche und persönliche Eignung für eine hausärztliche oder zahnärztliche Tätigkeit. So sollen neben strukturierten und fachspezifischen Studierfähigkeitstests, erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen in einem Gesundheitsberuf und dessen Ausübung für bis zu zwei Jahre oder eine mindestens einjährige Tätigkeit im Rahmen des Bundesfreiwilligen- oder Jugendfreiwilligendienstes genauso berücksichtigt werden wie eine mindestens zweijährige ehrenamtliche Tätigkeit. In das Auswahlverfahren sollen in der zweiten Stufe doppelt so viele Bewerber einbezogen werden, wie Plätze zur Verfügung stehen.
Die erfolgreichen Bewerber müssen dem Gesetz zufolge in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zusichern, ihre Verpflichtungen einzulösen und insbesondere die ärztliche- bzw. zahnärztliche Tätigkeit für die Dauer von mindestens zehn Jahren in dem betreffenden unterversorgten Gebiet auszuüben. Tun sie dies nicht, droht ihnen eine Vertragsstrafe von bis zu 250 000 Euro. Ausnahmen hat der Landtag für Verpflichtete in Mutterschutz und Schwangerschaft geschaffen. Entsprechende Unterbrechungszeiträume führen nicht zu einer Verlängerung des Zehn-Jahreszeitraums, sondern zur Anerkennung einer besonderen Härte, die zur zeitweisen Befreiung von den Verpflichtungen führt.
Nach der Regelung über die Voraussetzungen für die Zulassung können sich die Studenten aber auch entscheiden, eine Weiterbildung zu einem sonstigen Facharzt zu absolvieren, deren Absolventen sich an der hausärztlichen Versorgung in Bedarfsgebieten beteiligen können. Hierzu gehören beispielsweise Kinder- und Jugendärzte sowie Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung, die die Teilnahme an der hausärztlichen bzw. zahnärztlichen Versorgung gewählt haben.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz über die Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Gemeinden an Windparks (Drucksache 7/8233)
Thüringer Gemeinden werden künftig an den Erträgen von Windenergieanlagen beteiligt
Vorhabenträgerinnen und -träger von Windenergieanlagen müssen künftig sowohl die Standortgemeinde als auch die betroffenen Gemeinden nach § 6 Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) mit der dort vorgesehenen Höchstsumme von 0,2 Cent pro Kilowattstunde finanziell beteiligen. Dies ist Kern des vom Landtag verabschiedeten Thüringer Gesetzes über die Beteiligung von Gemeinden an Windparks (ThürWindBeteilG). Als Vorhabenträger sollen jene gelten, die eine Windenergieanlage errichten oder betreiben wollen. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines Umkreises von 2 500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet.
Ziel des Gesetzes ist, durch eine Beteiligung der Gemeinden die Akzeptanz für die Errichtung von Windkraftanlagen vor Ort zu steigern und auf diese Weise den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen. Das Gesetz soll so dazu beitragen, den vom Windenergieflächenbedarfsgesetz festgeschriebenen Flächenbeitragswert von 2,2 Prozent der Landesfläche Thüringens für die Windenergie bis 31.12.2032 zu erreichen. Im Fall der Errichtung einer modernen Windenergieanlage sei davon auszugehen, dass die berechtigten Gemeinden 27.600 € pro Jahr erhalten werden.
Die Gemeinden haben die aus der finanziellen Beteiligung an Windenergieanlagen erzielten Einnahmen zur Steigerung der Akzeptanz für Windenergieanlagen bei ihren Einwohnerinnen und Einwohnern zu verwenden. Hierfür kommen beispielsweise in Betracht: Maßnahmen zur Aufwertung des Ortsbilds und ortsgebundener Infrastruktur, zur Optimierung der Energiekosten oder des Energieverbrauchs oder zur Förderung kommunaler Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Kultur, der Bildung, sozialen Zwecken oder der Freizeit dienen, oder unternehmerischen Tätigkeiten in der Gemeinde. Für den Fall, dass die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger ihrer bzw. seiner Pflicht zur Beteiligung der Gemeinden nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommt, sieht das Gesetz die Zahlung einer Ausgleichsabgabe vor. Diese beträgt 0,5 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge.
Das Gesetz gilt für alle genehmigungsbedürftigen Windenergieanlagen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb genommen oder repowert werden.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Gesetz zur Einführung eines integrierten Bachelorgrades in der juristischen Ausbildung und Änderung des Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetzes (Drucksache 7/9427)
Bachelorgrad als neuer Abschluss im Studiengang Rechtswissenschaften eingeführt
Die Universität Jena kann künftig Studenten des Studiengangs Rechtswissenschaften unter gewissen Voraussetzungen den Bachelorgrad verleihen, ohne dass es eines Bestehens der Ersten Juristischen Prüfung bedarf. Dies hat der Landtag heute beschlossen. Bisher kann die Universität den Diplomgrad nur im Falle eines erfolgreichen Bestehens der Ersten Juristischen Prüfung verleihen.
Hintergrund ist zunächst der psychische Druck, der auf den Studenten aufgrund des Aufbaus des Studiums lastet. So verlässt man die Universität bisher ohne jeden Studienabschluss, wenn man die Erste Juristische Prüfung am Ende des rechtswissenschaftlichen Studiums (gesetzliche Regelstudienzeit: neun Semester) endgültig nicht besteht. Dies soll sich durch die Einführung des integrierten Bachelorgrades ändern. Das Gesetz verlangt hierfür, dass die Zulassungsvoraussetzungen für die Erste Juristische Prüfung erfüllt werden. Darüber hinaus müssen die Studierenden eine Bachelorarbeit oder eine äquivalente wissenschaftliche Leistung an der Friedrich-Schiller-Universität bestanden haben. Das Nähere regelt die Friedrich-Schiller-Universität Jena durch Satzung. Der integrierte Bachelorgrad ermöglicht es einerseits, den Studenten diese nachgewiesenermaßen erlangten juristischen Kenntnisse auch zu bescheinigen. Andererseits kann er die Grundlage für eine darauffolgende Einschreibung in einen konsekutiven Masterstudiengang bilden.
Weiterhin sieht das Gesetz eine Klarstellung im Thüringer Richter- und Staatsanwältegesetz (ThürRiStAG) in dem Sinne vor, dass die bereits heute in § 7 Abs. 6 ThürRiStAG vorhandene Verordnungsermächtigung auch die Festlegung eines Beurteilungsmaßstabs für die Beurteilung der Richter und Staatsanwälte erlaubt.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zur Sicherung der kinder-, jugend- und familiengerechten sozialen Infrastruktur in den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie den überregionalen Angeboten des Freistaats (Drucksache 7/6576)
Landtag legt höhere finanzielle Mindestausstattung für die Jugend- und Familienförderung fest
Der Landtag hat die finanzielle Mindestausstattung der örtlichen Jugendförderung, der Landesförderung der Schulsozialarbeit, der überörtlichen Maßnahmen der Jugendarbeit im Rahmen des Landesjugendförderplans und das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenlegen der Generationen“ gesetzlich festgeschrieben und erhöht. Zugleich legte das Parlament erstmals eine Mindestsumme für den Landesfamilienförderplan fest und erweiterte seine Kontrollrechte für den gesamten Bereich, der Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Dazu beschloss Thüringens Landesparlament Änderungen im Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz und im Thüringer Familienförderungssicherungsgesetz (ThürFamFöSiG).
Der jährliche Mindestzuschuss für die örtlichen Träger der örtlichen Jugendförderung steigt von 15 auf 17,92 Millionen Euro, jener für die freien Träger des Landesjugendförderplans von 3,8 auf 5,74 Millionen Euro. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen für die Schulsozialarbeit künftig 26,14 Millionen Euro zur Verfügung haben statt wie bisher 22,25 Millionen. In den genannten Fällen hat der Landtag dem zuständigen Ministerium aufgegeben, jährlich zu prüfen, ob die Mittel ausreichen, und den zuständigen Landtagsausschuss über das Ergebnis zu informieren. Dabei soll das Ministerium insbesondere die Personalkosten in den Blick nehmen.
Für das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ sieht der Landesgesetzgeber künftig eine Gesamtförderung von mindestens 15,92 statt wie bisher 10 Millionen Euro vor. Für die Umsetzung des Landesfamilienförderplans hat der Landtag erstmals einen Mindestzuschuss beschlossen. Er beläuft sich auf 2,35 Millionen Euro. In beiden Fällen ist ebenfalls eine fortlaufende jährliche Evaluierung und ein Bericht an den zuständigen Fachausschuss des Landtags vorgesehen. Für die im ThürFamFöSiG vorgesehenen einzelnen Familienfördermaßnahmen erlässt das zuständige Ministerium schon bisher Richtlinien oder erarbeitet sie. Neu ist, dass es dem zuständigen Landtagsausschuss berichten und das Benehmen herstellen muss.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes (Drucksache 7/8644 - Neufassung -)
Gesetzlicher Personalschlüssel in Kindergärten verbessert
Eine pädagogische Fachkraft soll in Thüringer Kindertageseinrichtungen künftig für weniger Kinder zuständig sein. Der Landtag hat jetzt eine entsprechende Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes beschlossen. Der geänderte Betreuungsschlüssel soll der Qualität der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Thüringen zugutekommen. Dem gleichen Zweck dient ein Auftrag des Landtags an das für die Kindertagesstätten zuständige Ministerium, mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege Vereinbarungen über die Qualitätssicherung und -entwicklung zu schließen.
Wurde bei den Betreuungsrelationen bisher zwischen sieben Altersgruppen unterschieden, so hat der Landtag jetzt nur noch vier festgelegt. Eine Erzieherin oder ein Erzieher betreut wie bisher vier Kinder im Alter bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres. Sechs Kinder zwischen dem ersten und dritten Geburtstag werden sich zukünftig eine pädagogische Fachkraft teilen. Davon profitieren vor allem die Zweijährigen, für die der Betreuungsschlüssel bisher bei eins zu acht liegt.
Für die Kinder vom dritten Geburtstag an bis zur Einschulung beträgt das Verhältnis zukünftig durchgängig eins zu zwölf. Bisher müssen sich 14 Vierjährige und 16 Fünfjährige eine Erzieherin oder einen Erzieher teilen. Für Grundschüler ändert sich nichts: Wie bisher bleibt eine Fachkraft für 20 Kinder zuständig.
Die neuen Betreuungsschlüssel gelten grundsätzlich vom 1. Januar 2025 an. Sofern die Träger nicht in der Lage sind, die gesetzlichen Mindestpersonalschlüssel unmittelbar zu gewährleisten, räumt der Landtag ihnen eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2027 ein.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zur Ausreichung von Leistungen an Kommunen zur Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern (Drucksache 7/9866)
Landtag unterstützt Kommunen mit Hallenbädern finanziell
Der Landtag entlastet Städte und Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern, die ein Hallenbad betreiben, in dem regelmäßig schulischer Schwimmunterricht stattfindet. Unter diesen Voraussetzungen erhalten sie einmalig eine pauschale Zuweisung von bis zu fünf Millionen Euro, mit der ihre durch die Energiekrise bedingten Mehrausgaben ausgeglichen werden können. Die Summe wird auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt. Die Zuweisungen werden aus den im Sondervermögen „Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds“ bereitgestellten Mitteln gezahlt.
Die Unterstützung soll sich auf Hallenbäder, einschließlich Thermen oder vergleichbare räumlich umschlossene Schwimmstätten, beschränken, die durch Gemeinden selbst oder ein kommunales Unternehmen betrieben werden, das in ihrem Mehrheitsbesitz steht. Der regelmäßige schulische Schwimmunterricht muss für das erste Halbjahr 2024 nachgewiesen werden. Die Auszahlung soll bis Ende August 2024 erfolgen.
Kommunen mit Schwimmbädern sind durch die Preissteigerungen im Energiebereich besonders belastet und die Geschäftsgrundlage der Schwimmbäder dadurch gefährdet. Die einmalige Zuweisung an die betroffenen Kommunen ist laut Gesetzesbegründung in Anbetracht der besonderen Bedeutung der Schwimmbäder nicht nur für den Vereins- und Freizeitsport, sondern auch für den Schwimmunterricht der Schulen angezeigt.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes (Drucksache 7/8242)
Umfangreiche Änderungen in der Kinder- und Jugendhilfe beschlossen
Der Landtag hat die Kinder- und Jugendhilfe umfassend reformiert. Die nun beschlossenen Änderungen gehen teils auf Bundesgesetze zurück, aus denen sich landesrechtlicher Anpassungsbedarf im Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz (ThürKJHAG) ergibt, teils ergab sich ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf aus der langjährigen Praxis der Kinder- und Jugendhilfe in Thüringen. Die Änderungen betreffen fünf Aufgabenbereiche.
Zunächst verbessert das Parlament den Kinder- und Jugendschutz, indem es einen Rechtsanspruch auf spezialisierte Beratung und Unterstützung bei Kindswohlgefährdung, den Landesbeauftragten für Kinderschutz und die Landeskoordinierungsstelle für medizinischen Kinderschutz im ThürKJHAG verankert.
Kinder und Jugendliche, die in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen, werden unter anderem durch Neuregelungen bei Betriebserlaubnissen und eine eigenständige Jugendhilfeplanung „Hilfen zur Erziehung“ gestärkt.
Hilfen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen kommen im Sinne inklusiver Kinder- und Jugendhilfe künftig aus einer Hand und Vertreter von Behindertenorganisationen werden als beratende Mitglieder in die Jugendhilfeausschüsse einbezogen.
Die Prävention vor Ort wird verbessert, etwa durch den Ausbau der Schulsozialarbeit und eine gestärkte außerschulische Jugendbildung.
Schließlich entwickelt der Gesetzgeber die Beteiligung junger Menschen, Eltern und Familien weiter. So wird unter anderem eine Kinder- und Jugendhilfe-Ombudsstelle mit mindestens zwei Außenstellen eingerichtet und gesetzlich verankert.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zum Erlass und zur Änderung ehrenamtsrechtlicher Vorschriften (Drucksache 7/9426)
Anerkennung und Förderung des Ehrenamts und bürgerschaftlichen Engagements erstmals in eigenem Gesetz geregelt
Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement soll in Thüringen dauerhaft gefördert, gestärkt, ausgebaut und damit zugleich besonders anerkannt werden. Dazu hat der Thüringer Landtag jetzt mit einem Ehrenamtsgesetz eine verbindliche und einheitliche rechtliche Grundlage geschaffen, in der bereits vorhandene Regeln und Maßnahmen gebündelt werden. Der Landtag setzt damit das in Artikel 41 a der Thüringer Verfassung jüngst festgeschriebene Staatsziel um, ehrenamtliches Engagement zu schützen und zu fördern.
Gegenstände des neuen Gesetzes sind unter anderem besondere Leistungen, Formen der Anerkennung, die Definition des „Ehrenamts“, die institutionelle Förderung für die „Thüringer Ehrenamtsstiftung“ und die „Thüringer Ehrenamtscard“ sowie ein noch einzurichtendes Landesprogramm zur „Stärkung bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements im Freistaat Thüringen“ außerhalb des öffentlichen Ehrenamts.
Erweitert werden dafür die bestehenden Förderinstrumente bzw. – möglichkeiten, etwa für den Bereich des Sports. Zudem soll auch in anderen Bereichen ehrenamtliches Engagement erleichtert werden, unter anderem durch den Abbau bürokratischer Hürden, reduzierten Auflagen bei der Einhaltung des Datenschutzes sowie einer stärkeren Würdigung ehrenamtlicher Betätigung in den Schulen.
Mit der Einrichtung eines Landesprogramms will der Landtag die finanzielle Unterstützung für die gesamte Bandbreite bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements verbessern. Gefördert werden sollen künftig etwa Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote, Leistungen in Verbindung mit der Thüringer Ehrenamtscard, die Finanzierung und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten, eine Entlastung bei den Kosten der GEMA-Gebühren, eine finanzielle Unterstützung in existenziellen Notlagen, die Übernahme von Entschädigungsleistungen bei Gesundheitsschäden, die Finanzierung von Freiwilligenagenturen, flächendeckend in Thüringen, Rechtsberatungskosten zu Steuer- und Vereinsrecht oder auch Aufwendungen und Sachkosten zur Unterstützung der ehrenamtlichen Betätigung von Menschen mit Behinderungen.
Für die Arbeit der bestehenden Ehrenamtsstiftung und die bereits vorhandenen Freiwilligenagenturen sowie die „Thüringer Ehrenamtscard“ schreibt Thüringens Landesparlament eine finanzielle Basis gesetzlich fest und schafft die dafür notwendigen rechtlichen Grundlagen. Außerdem sollen der Landessportbund Thüringen e.V. und die LIGA der freien Wohlfahrtspflege stärker an den Erträgen der Thüringer Staatslotterie beteiligt werden.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzes (Drucksache 7/9658)
Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz umfassend reformiert
Der Thüringer Landtag hat den Brand- und Katastrophenschutz in Thüringen umfassend reformiert und dazu das Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) in weiten Teilen neu gefasst. Mit der umfassenden Novelle reagiert das Parlament auf den gesellschaftlichen Wandel und die demographische Entwicklung, die sich auch auf das Ehrenamt bei den Feuerwehren und im Katastrophenschutz auswirken. Neue Herausforderungen ergeben sich ebenso aus der Digitalisierung, dem Klimawandel und der Energiewende, etwa der Elektromobilität.
Das Gesetz ist in einem längeren Konsultationsprozess vorbereitet worden, an dem Institutionen und Organisationen des Brand- und Katastrophenschutzes beteiligt waren. Ziel war, das Gesetz in einem möglichst breiten Konsens zu entwickeln. Der Landtag hat mit dem Gesetz die organisatorischen und personellen Voraussetzungen für die Aufstellung von Feuerwehren neu gefasst. Mit Blick auf die demographische Lage und die Nachwuchsgewinnung verdoppelt sich die Jugendfeuerwehrpauschale je Angehörigem von 25 auf 50 Euro. Künftig müssen zudem bereits Städte mit 60.000 Einwohnern eine Berufsfeuerwehr vorhalten. Dazu waren bisher erst Städte mit 100.000 und mehr Einwohnern verpflichtet. Neu ist auch eine detaillierte Kostenregelung, in der festgehalten ist, für welche Einsätze der Feuerwehr Kosten in Rechnung gestellt werden können, etwa bei Fehlalarmen.
Im Bereich Katastrophenschutz hat der Landesgesetzgeber die Regeln für die aufzustellenden Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen präzisiert. Die Befugnisse werden klarer geregelt und die Mitwirkungsmöglichkeiten von privaten Organisationen im Katastrophenschutz erweitert. Auch für eine Auskunftsstelle bei der Katastrophenschutzbehörde gibt es nun eine gesetzliche Grundlage.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Aufbaubankgesetzes (Drucksache 7/9865 – korrigierte Fassung -)
Aufbaubank soll zukünftig auch Wohnungsbau, Energie und Dekarbonisierung fördern
Die Thüringer Aufbaubank soll künftig auch in den Bereichen Wohnungsbau, Energie und Dekarbonisierung fördern können. Die entsprechenden Aufgaben hat der Landtag jetzt in das Thüringer Aufbaubankgesetz (ThürAufbBG) eingefügt. Damit die Thüringer Aufbaubank diesen Aufgaben gerecht werden kann, hat der Landesgesetzgeber zugleich angewiesen, das Eigenkapital der Thüringer Förderbank um rund 150 Prozent von 33,23 auf 83,23 Millionen Euro zu erhöhen.
Der Landtag setzt damit eigene Beschlüsse vom April und Dezember 2023 um, die sich mit dem erheblichen Investitions- und Anpassungsbedarf im Rahmen des Klimaschutzes auseinandersetzen. Die Aufbaubank soll dem Landtag zukünftig außerdem jährlich berichten, welche Investitionen durch die Eigenkapitalerhöhung möglich geworden sind und wie sie sich auf die mannigfaltigen Förderaufgaben der Bank aufteilen.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes (Drucksache 7/9640)
Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz modernisiert
Der Landtag hat das Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz (ThürAIKG) an europa- und bundesrechtliche Änderungen angepasst. In diesem Zug und unabhängig davon wurde das Berufsrecht für Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Ingenieure und Beratende Ingenieure modernisiert.
Das Gesetz umfasst in diesem Sinne eine Fülle einzelner Maßnahmen. Unter anderem wird den genannten freien Berufen nun ermöglicht, ihre Berufstätigkeit auch in Personenhandelsgesellschaften auszuüben. Damit steht ihnen eine größere Auswahl zulässiger Gesellschaftsformen zur Verfügung. Die Bestimmungen zur Wahrung der Berufspflichten im Rahmen gesellschaftlicher Zusammenschlüsse werden neu geregelt.
Daneben führt das Parlament zudem einen Rechtsanspruch auf die isolierte Feststellung der Gleichwertigkeit einer ausländischen Berufsqualifikation außerhalb von Genehmigungs- und Eintragungsverfahren und das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren ein. So soll die Einwanderung von Fachkräften für die im ThürAIKG reglementierten Berufe unterstützt werden.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier
Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Versorgungswerk der Rechtsanwälte (Drucksache 7/8875)
Landtag schließt Regelungslücken im Thüringer Gesetz über das Versorgungswerk der Rechtsanwälte
Die Mitgliedschaft von Rechtsanwälten im Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Thüringen beginnt künftig mit dem Tag, an dem sie durch die Rechtsanwaltskammer als Rechtsanwälte zugelassen werden. Der Thüringer Landtag hat das Thüringer Gesetz über das Versorgungswerk der Rechtsanwälte entsprechend geändert.
Überdies stellte er klar, dass die Tätigkeit als Mitglied in der Vertreterversammlung oder einem Ausschuss des Versorgungswerks ehrenamtlich erfolgt und lediglich eine angemessene Aufwandsentschädigung gezahlt und Reisekosten erstattet werden. Damit will der Landtag bestehende Unsicherheiten in steuerrechtlichen Fragen beseitigen.
Schließlich ermächtigen die Abgeordneten das Versorgungswerk, Daten über die Anschrift, den Aufenthaltsort und den Arbeitgeber an eine öffentliche Stelle weiterzugeben, sofern diese aufgrund gesetzlicher Befugnisse danach verlangt. Damit wird ein Gleichklang zwischen dem Recht, diese Daten zu erheben, und der Pflicht hergestellt, derartige Daten weiterzugeben. Konkreter Anlass war, dass der Bundesgesetzgeber 2021 die Rechte von Gerichtsvollziehern, Insolvenzgerichten und anderen Vollstreckungsbehörden erweitert hat, Drittauskünfte zu erheben.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (Drucksache 7/9421)
Land übernimmt wieder ein Drittel der Kosten für die Tierkörperbeseitigung
Die Gebühren für die Abholung, Sammlung, Kennzeichnung, Beförderung, Lagerung, Verarbeitung, Verwendung und Beseitigung in Bezug auf Tierkörper von Vieh (Tierkörperbeseitigung) werden künftig wieder zu einem Drittel vom Land getragen. Dies sieht das verabschiedete Erste Gesetz zur Änderung des Thüringer Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vor.
Damit soll zu der bis zum 1. August 2011 geltenden Kostenaufteilung zurückgekehrt werden, wonach die vorgenannten Gebühren zu jeweils einem Drittel von den Besitzern der Tierkörper, den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie dem Land getragen wurden. Dies soll zu einer Entlastung der Besitzer von Tierkörpern beitragen, die nach bisher geltender Rechtslage zwei Drittel der Gebühren zu tragen hatten. Die Gebühren sind in den letzten Jahren aufgrund der Kostensteigerungen im Energiesektor stark angestiegen. Ziel ist, im Sinne einer verantwortungsgerechten Wahrnehmung der staatlichen Aufgaben der Tierseuchenprävention und -bekämpfung eine sozialverträgliche Lösung, die den Gefahren einer illegalen Entsorgung, wie etwa einer erhöhten Seuchengefahr, sowie einem zuletzt bestehenden weiteren Rückgang der Nutztierbestände in Thüringen entgegenwirkt. Über eine Verordnungsermächtigung wird das Land zudem in die Lage versetzt, flexibel auf eine veränderte Sachlage zu reagieren und die Kostenbeteiligung bei Bedarf entsprechend anzupassen und die Gebühren für die Besitzer bis zu einem Anteil von maximal zwei Dritteln zu erhöhen. Dem Land entstehen mit der Gesetzesänderung zusätzliche Ausgaben in Höhe von ca. 2.734.000 € pro Jahr.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Chancengleichheitsfördergesetzes – Ausbau und Förderung von Einrichtungen und Angeboten des Gewaltschutzes (Drucksache 7/8244)
Thüringer Landtag stärkt Schutzeinrichtungen für von Gewalt Betroffene
Das Land soll zukünftig notwendige Kosten der Schutzeinrichtungen für Personen, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind, finanzieren. Sie sind insbesondere für Frauen und die in deren Obhut befindlichen Kinder gedacht. Das hat der Landtag beschlossen. Mit dem Gesetz soll der Gesetzesbegründung zufolge vor allem das von Deutschland ratifizierte Übereinkommen des Europarates gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt (Istanbul-Konvention) auf Landesebene umgesetzt werden.
Durch die vorgesehene Finanzierung durch das Land sollen die Träger von Einrichtungen Planungssicherheit erhalten und der kostenfreie Zugang zu Frauenhäusern und Schutzwohnungen ohne bürokratische Hürden ermöglicht werden. Qualitative Vorgaben sollen gewährleisten, dass die Angebote der Schutzeinrichtungen besondere Belange betroffener Personen berücksichtigen, etwa die religiösen, weltanschaulichen und soziokulturellen Bedürfnisse sowie ihre sexuelle Orientierung. Gefördert werden sollen auch Interventionsstellen und geschlechtsspezifische Beratungsangebote für Personen, die von Gewalt in einem umfassenden Sinn betroffen sind. Träger von Schutzeinrichtungen oder Interventionsstellen benötigen eine Anerkennung durch das Land. Auch Frauenhäuser sollen wie bisher als Teil des sozialen Hilfssystems für Frauen gefördert werden. Der Begründung des Gesetzentwurfs zufolge verstehen sie sich als Orte der Begegnung, Kommunikation, Bildung und Kultur.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
April 2024
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen (Beschlussempfehlung in Drucksache 7/9936)
Landtag ändert Verfassung des Freistaats Thüringen
Ein Diskriminierungsverbot des Alters wegen, ein neuer Abschnitt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, genauere Bestimmungen zu europapolitischen Zielen und Verfahren, die elektronische Ausfertigung von Gesetzen und Rechtsverordnungen sowie die bessere Absicherung der Kommunalfinanzen in der Verfassung – das sind die wesentlichen Änderungen in der Verfassung des Freistaats Thüringen (ThürVerf), die der Landtag jetzt nach mehrjährigen Beratungen in einem eigens eingerichteten Verfassungsausschuss beschlossen hat. Der Ausschussberatung lagen acht unterschiedliche Gesetzentwürfe zugrunde.
Die Änderungen im Einzelnen: Die in Art. 2 Abs. 3 ThürVerf aufgezählten Diskriminierungsverbote werden ergänzt. Künftig darf auch niemand „seines Alters“ wegen „bevorzugt oder benachteiligt werden“. Ein Verbot der Altersdiskriminierung enthält bereits die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU). In Art. 20 Abs. 3 ThürVerf werden aus „Behinderten“ „Menschen mit Behinderungen“, da der ursprüngliche Begriff als nicht mehr zeitgemäß angesehen und demzufolge auch nicht mehr verwendet wird.
Der Schutz und die Förderung des ehrenamtlichen Einsatzes (Art. 41a ThürVerf), das Prinzip der Nachhaltigkeit als „Grundlage allen staatlichen Handelns“ (Art. 41b ThürVerf) und die Aufforderung an das Land und seine Gebietskörperschaften, „gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen, in Stadt und Land“ zu fördern und zu sichern, werden im ersten Teil der Verfassung zu einem neuen siebten Abschnitt unter der Überschrift „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ zusammengefasst.
Die EU und die politischen Erfordernisse der europäischen Integration schlagen sich in gleich mehreren Änderungen nieder. Der Freistaat definiert sich als Land der Bundesrepublik Deutschland und, über diese Eigenschaft vermittelt, als „Teil der Europäischen Union“ (Art. 44 Abs. 1 ThürVerf). In einem neuen Absatz 2 in Art. 44 ThürVerf formuliert der Landtag das Staatsziel, ein geeintes Europa zu verwirklichen und zu entwickeln, „das den Grundsätzen der Demokratie, des Rechtsstaats, des Sozialstaats und des Föderalismus sowie der Subsidiarität verpflichtet ist“. Das Land soll die europäische Kooperation und Verständigung fördern und für die „Mitwirkung der Regionen und ihrer Bürger an europäischen Entscheidungen“ eintreten.
In einem neuen Absatz 5 in Art. 67 ThürVerf werden Rechte des Landtags im Rahmen der unionsrechtlichen Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung verankert. Der Europaausschuss ist nach dem neuen Art. 62 a ThürVerf nun qua Verfassung, ein „in Angelegenheiten der Europäischen Union beschließender Ausschuss“. Um die Rechtsetzung der EU kontinuierlich begleiten zu können, muss er, anders als die anderen Fachausschüsse, bereits in der konstituierenden Sitzung jedes neuen Landtags gebildet werden.
Als Kann-Bestimmung wird in die Verfassung die Möglichkeit aufgenommen, Gesetze und Rechtsverordnungen in elektronischer Form auszufertigen und zu verkünden und das Gesetz- und Verordnungsblatt so zu führen (Art. 85 Abs. 1 Satz 3 ThürVerf).
Die für die Kommunen wichtigste Änderung dürfte sich in dem für die Kommunalfinanzen grundlegenden Art. 93 ThürVerf finden. Dieser enthält bisher lediglich eine ausdrückliche Regelung zum angemessenen finanziellen Ausgleich für staatliche Aufgaben, die das Land den Kommunen übertragen hat (Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis). Ausdrücklich in der Verfassung verankert wird nun zusätzlich die Pflicht des Landes, Gemeinden und Gemeindeverbänden einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu schaffen, wenn es ihnen die Verpflichtung auferlegt, bestimmte Aufgaben des eigenen Wirkungskreises zu erfüllen (Pflichtaufgaben). Zu solchen Pflichtaufgaben gehören bspw. die Bauleitplanung oder der öffentliche Personennahverkehr. Bei ihnen steht fest, dass die Kommune sie unter bestimmten Voraussetzungen wahrnehmen muss, hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Pflichterfüllung ist sie aber frei. Die Finanzierungspflicht gilt daneben aber auch dann, wenn das Land „besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben“ stellt.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Landesplanungsgesetzes – Sicherung der raumordnerischen Steuerung des Windenergieausbaus (Drs. 7/9392)
Regionale Planungsgemeinschaften können Windenergieausbau zukünftig auch in der Aufstellungsphase von Raumordnungsplänen steuern
Das Landesverwaltungsamt kann als obere Landesplanungsbehörde den Bau von Windenergieanlagen an bestimmten Standorten zukünftig befristet untersagen, wenn eine regionale Planungsgemeinschaft beschlossen hat, einen Regionalplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen, um Windvorranggebiete für den Windenergieausbau in ihrer Planungsregion festzulegen. Diese sogenannten befristeten raumordnerischen Untersagungen gelten längstens bis zum Jahresende 2027. Das hat der Thüringer Landtag beschlossen. Mit der entsprechenden Ergänzung des Thüringer Landesplanungsgesetzes soll ein ungesteuerter Windenergieausbau verhindert werden.
Hintergrund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Weimar vom 22. November 2022. Das Gericht hatte den 1. Sachlichen Teilplan Windenergie des Regionalplanes Mittelthüringen aus dem Jahr 2018 für ungültig erklärt. Damit sind die bisherigen Vorranggebiete Windenergie aufgehoben und Windenergieanlagen können praktisch überall außerhalb von Ortschaften bevorzugt errichtet werden, um die Energiewende zügig voranzutreiben. Es bestand damit das Risiko, dass Windenergieanlagen auch außerhalb der in der laufenden Planung vorgesehenen Vorranggebiete hätten errichtet werden können. Dagegen kann das Landesverwaltungsamt mit dem neuen Instrument nun vorgehen.
Befristete raumordnerische Untersagungen nach dieser Ergänzung des Landesplanungsgesetzes können in folgenden Fällen nicht ausgesprochen werden: bei Repoweringvorhaben und wenn Windenergieanlagen auf Flächen errichtet werden sollen, die Gemeinden dafür ausgewiesen haben oder die im Entwurf des Regionalplans beziehungsweise des sachlichen Teilplans als Vorranggebiete für Windenergie vorgesehen sind.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zu dem Fünften Medienänderungsstaatsvertrag (Drucksache 7/9817)
Landtag stimmt Änderungen am Medienstaatsvertrag und am Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und damit insbesondere europarechtlichen Folgeanpassungen zu
Der Landtag hat den Fünften Medienänderungsstaatsvertrag gebilligt. Damit kann die Landesregierung für Thüringen die Ratifikationsurkunde beim Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK) hinterlegen. Mit dem Staatsvertrag soll der Medienstaatsvertrag in der seit dem 1. Januar 2024 gültigen Fassung mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 geändert werden.
Der Änderungsstaatsvertrag passt den Medienstaatsvertrag an die Anforderungen des Digital Services Acts (DSA) der Europäischen Union an, der auf Bundesebene im Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) umgesetzt werden soll. Diese Normen beschäftigen sich insbesondere mit der Sicherheit im Internet. Der Medienstaatsvertrag schafft dabei insbesondere eine Kollisionsnorm, die das Verhältnis der europarechtlichen Regelungen zu den Regelungen des Staatsvertrags näher erläutert. Gleichzeitig berücksichtigt er die Besonderheiten der deutschen Medienregulierung, indem er bspw. weiterhin den Begriff des Telemediums nutzt, währenddessen insbesondere das DDG den engeren Begriff des digitalen Diensts verwendet.
Daneben enthält der Änderungsstaatsvertrag die Klarstellung, dass die reichweitenstärksten bundesweit verbreiteten Fernsehvollprogramme der beiden größten Veranstaltergruppen weiterhin Regionalfensterprogramme senden müssen. Dies wird mit der Sicherung der Meinungsvielfalt begründet und bedeutet praktisch, dass RTL und ProSieben/Sat. 1 Regionalfensterprogramme ausstrahlen müssen. Unter Regionalfensterprogrammen versteht man ein zeitlich und räumlich begrenztes Rundfunkprogramm mit im Wesentlichen regionalen Inhalten im Rahmen eines Hauptprogramms.
Vertragspartner des Medienstaatsvertrags sind die 16 deutschen Länder. Nur wenn alle Parlamente zustimmen und sämtliche Ratifikationsurkunden bis zum 30. September 2024 beim Vorsitzenden der MPK eingegangen sind, tritt der Medienänderungsstaatsvertrag am Folgetag in Kraft. Andernfalls gilt der Medienstaatsvertrag in seiner aktuellen Fassung weiter. Vorausgesetzt, die Änderungen am Medienstaatsvertrag treten in Kraft, werden sie mit dem beschlossenen Zustimmungsgesetz des Landtags zugleich in Thüringer Landesrecht transformiert.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zu dem Zweiten Änderungsstaatsvertrag zur Versorgung der Steuerberater in Thüringen (Drs. 7/9854)
Landtag stimmt Änderungen am Staatsvertrag zur Versorgung der Steuerberater in Thüringen zu: Nur Steuerberater und Steuerbevollmächtigte können Mitglied des Versorgungswerkes der Steuerberater werden
Der Landtag hat sichergestellt, dass in Thüringen auch in Zukunft nur Steuerberater und Steuerbevollmächtigte Mitglied des für sie mit zuständigen nordrhein-westfälischen Versorgungswerks der Steuerberater werden können. Er reagiert damit auf Änderungen des Bundesgesetzgebers im Steuerberatungsgesetz, die es Angehörigen einiger anderer freier Berufe ermöglichen, Mitglied in den Steuerberaterkammern der Länder zu werden und ggf. auch in den entsprechenden Versorgungswerken. Formal hat der Landtag dazu den Zweiten Änderungsstaatsvertrag zur Versorgung der Steuerberater in Thüringen gebilligt. Damit kann die Landesregierung die Ratifikationsurkunden mit dem Land Nordrhein-Westfalen austauschen. Dies ist für das Inkrafttreten des Staatsvertrags zwingend erforderlich. Mit Inkrafttreten werden die vereinbarten Änderungen mit dem nun beschlossenen Zustimmungsgesetz des Landtags zugleich in Thüringer Landesrecht transformiert.
Zum Hintergrund: Steuerberater sind in einem berufsständischen Versorgungswerk alters-, invaliditäts- und hinterbliebenenversichert. Die berufsständische Versorgung gehört im System der Alterssicherung in Deutschland zusammen und gleichberechtigt mit der gesetzlichen Rentenversicherung zur Regelsicherung der „1. Säule“ der Altersversorgung. Laut des Versorgungsauftrages der berufsständischen Versorgungswerke setzen sich die Mitglieder aus den Angehörigen bestimmter Berufsgruppen zusammen. Ziel der Versorgungswerke ist es, diesen Mitgliedern eine stabile Versorgung zu gewährleisten. Um diesem Auftrag nachkommen zu können, ist u.a. eine einheitliche Risikostruktur des jeweiligen Versorgungswerks notwendig, die durch die Ausrichtung auf einen bestimmten Berufsstand entsteht. Die Versorgung für die Thüringer Steuerberater wird aufgrund des zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Freistaat Thüringen geschlossenen Staatsvertrags vom Versorgungswerk der Steuerberater im Land Nordrhein-Westfalen mitübernommen.
Nach dem geänderten Steuerberatungsgesetz können Angehörige der im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz genannten freien Berufe, wie z.B. Ärzte, Heilpraktiker und Architekten unter bestimmten Voraussetzungen Mitglied in der Steuerberaterkammer Thüringen werden und in der Folge damit ggf. Mitglied des Versorgungswerks der Steuerberater im Land Nordrhein-Westfalen. Damit droht eine Aufweichung der bislang weitgehend einheitlichen Risikostruktur der Versichertengemeinschaft. Nachdem der Gesetzgeber Nordrhein-Westfalens hierauf bereits reagiert hatte, wurde nun in der Folge der dazugehörige Staatsvertrag angepasst. Nun sollen nachträglich ab dem 1. August 2022 nur noch Steuerberater und Steuerbevollmächtigte und nicht mehr Angehörige anderer Berufe, die der Steuerberaterkammer Thüringen als Mitglied angehören, Mitglied des Versorgungswerkes werden können.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes – Gute Bildung und Stärkung der Elternrechte (Drucksache 7/5371) und Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Schulgesetzes - Modernisierung des Schulwesen (Drucksache 7/6573)
Digitales und praxisorientiertes Lernen, Entlastung für Lehrer und mehr Raum für den Elternwillen: Landtag ändert das Thüringer Schulgesetz
Digitales Lernen und Distanzunterricht, mehr Praxis- und Berufsorientierung in den Schulen, Entscheidungsrechte für Eltern von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf und die Entlastung der Lehrer durch pädagogische Assistenten und Verwaltungsassistenten, das sind einige wesentliche Punkte aus der jetzt beschlossenen Änderung des Thüringer Schulgesetzes. Der Novelle liegen Gesetzentwürfe der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 7/6573) einerseits und der Fraktion der CDU und der Parlamentarischen Gruppe der FDP (Drucksache 7/5371) andererseits zugrunde.
Den neuen gesetzlichen Regeln zum Distanzunterricht und Digitalen Lernen stellt der Landtag den Grundsatz voran, dass der Präsenzunterricht der Regelfall bleibt. Distanzunterricht soll es nur auf der Grundlage eines von der Schulkonferenz beschlossenen Konzepts geben, unter bestimmten Bedingungen auch außerhalb des Schulgebäudes. Dafür ist grundsätzlich der Einsatz digitaler Lehr- und Lernmittel vorgesehen. Das Bildungsministerium ist nun auch gesetzlich verpflichtet, den Zugang zu diesen Mitteln über eine digitale Lernplattform sicherzustellen. Praxisorientiertes Lernen und berufliche Orientierung hat der Landesgesetzgeber zum durchgängigen Prinzip des Unterrichts an Regelschulen erklärt. Darauf soll vor allem in den Klassen 5 bis 10 Wert gelegt werden.
Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf findet „nach Maßgabe der vorhandenen oder mit vertretbarem Aufwand zu schaffenden personellen, sächlichen und räumlichen Voraussetzungen“ auch weiterhin in den allgemeinbildenden Schulen statt. Schulamt und Schulträger legen für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf einen geeigneten Lernort fest. Eltern steht es in Zukunft jedoch frei, eine andere geeignete Schule oder eine Förderschule zu wählen. Zudem erhalten sie das Recht, ein schulpflichtiges Kind nach einer schulärztlichen Untersuchung und Beratung durch die Schule unter bestimmten Voraussetzungen einmalig ein Jahr vor der Einschulung zurückstellen zu lassen.
Pädagogische Assistenzen sollen zukünftig Lehrer, Erzieher und sonderpädagogische Fachkräfte „bei der Erziehung, Beratung, Betreuung und Förderung der Schüler und der Zusammenarbeit mit den Eltern“ unterstützen und damit entlasten. Für Entlastung der Schulleiter und Lehrer sollen zukünftig auch Schulverwaltungsassistenten sorgen. Sie können für eine oder mehrere Schulen zuständig sein. Für beide Assistenzen soll das Bildungsministerium die fachlichen Voraussetzungen klären.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz über die Neufassung des Berufsrechts der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (Drucksache 7/9414)
Landtag aktualisiert Berufsrecht der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
Der Landtag hat das Berufsrecht der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure umfassend aktualisiert und dazu das aus dem Jahr 2005 stammende Thüringer Gesetz über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ThürGÖbVI) durch das jetzt verabschiedete Ablösungsgesetz ersetzt. Die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure nehmen amtliche Aufgaben im Vermessungswesen wahr. So sind in Thüringen insbesondere diese Ingenieure für Vermessungen an Flurstücks- und Grundstücksgrenzen privater und kommunaler Antragsteller zuständig.
Mit dem Ablösungsgesetz will der Landtag die Arbeit der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure erleichtern und Bürokratie abbauen. So hat das Parlament einzelne Genehmigungsvorbehalte in Anzeigepflichten umgewandelt und die berufliche Zusammenarbeit der Ingenieure flexibler gestaltet. Künftig ist es etwa erlaubt, die knappen Fachkräfte untereinander auszutauschen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Damit überall in Thüringen das Angebot von hoheitlichen Liegenschaftsvermessungen abgesichert werden kann, ist die Möglichkeit vorgesehen, einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur vorübergehend auch einen zweiten Amtsbezirk zuzuweisen.
Im Wesentlichen beibehalten, wenn auch präzisiert, hat der Landtag die bisherigen Voraussetzungen, unter denen Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bestellt werden können. Der Berufsstand hatte in der Anhörung im Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten darauf gedrungen, die entsprechenden Bestimmungen nicht aufzuweichen, um die Qualität der Ausbildung und der Leistungen zu wahren.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Heilberufegesetzes (Drucksache 7/8921)
Thüringer Heilberufegesetz an EU-Richtlinien angepasst
Der Landtag hat das Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) aufgrund seiner Pflicht zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen angepasst. Danach ist vor der Einführung neuer oder Änderung bestehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Bezug auf den Zugang oder die Ausübung von reglementierten Berufen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen.
Die Nachbesserung ist erforderlich, weil die Europäische Kommission die Auffassung vertritt, dass der in diesem Zusammenhang im Jahr 2020 erlassene neue § 5c ThürHeilBG die Begriffsbestimmungen aus Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht ausreichend umsetzte. Die Begriffsbestimmungen werden nunmehr in einer Anlage zum ThürHeilbG aufgenommen und weitere, notwendige Folgeänderungen geregelt.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
März 2024
Thüringer Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (Drs. 7/9645)
Landtag stimmt den Änderungen des Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen zu
Der Landtag hat das Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen gebilligt. Damit kann die Landesregierung für Thüringen die Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegen. Mit dem Abkommen soll das Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970 erneut geändert werden, nachdem es zuletzt durch das Abkommen vom 20. Dezember 2001 geändert worden ist.
Das Institut soll künftig die Bezeichnung „Institut für medizinische, pharmazeutische, zahnmedizinische und psychotherapeutische Prüfungen“ tragen. Mit dem Abkommen soll es auch Prüfungsfragen für die zahnärztliche Ausbildung im Sinne der zahnärztlichen Approbationsordnung erstellen. Außerdem soll das Institut künftig Aufgaben wahrnehmen, die den Anforderungen genügen, die sich aus der grundlegenden Novellierung der Psychotherapeutischen Ausbildung ergeben.
Vertragspartner des Abkommens sind die 16 deutschen Länder, Freistaaten und Freien Hansestädte. Nur wenn alle Parlamente zustimmen und sämtliche Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz eingegangen sind, tritt das Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Kraft. Andernfalls gilt das Abkommen in seiner aktuellen Fassung weiter. Vorausgesetzt, die Änderungen am Abkommen treten in Kraft, werden sie mit dem beschlossenen Zustimmungsgesetz des Landtags zugleich in Thüringer Landesrecht transformiert.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zu dem Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags (Drs. 7/9639)
Landtag stimmt Änderungen am IT-Staatsvertrag zu: sicheren und flexibleren Finanzierungsmöglichkeiten für Vorhaben des IT-Planungsrats Rechnung getragen
Der Landtag hat den Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags gebilligt. Damit kann die Landesregierung für Thüringen die Ratifikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK) hinterlegen. Mit dem Staatsvertrag soll der IT-Staatsvertrag vom 30. Oktober bis 30. November 2009 erneut geändert werden, der durch den Staatsvertrag vom 15. bis 21. März 2019 bereits einmal geändert worden ist.
Mit dem Regelwerk soll der Tatsache, dass die Digitalisierung der Verwaltung eine Daueraufgabe ist, Rechnung getragen werden, und es sollen sichere und flexiblere Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden. Vorgesehen ist, die Finanzierung der als Anstalt des öffentlichen Rechts errichteten Föderalen IT-Kooperation (FITKO) durch ein dauerhaftes Digitalisierungsbudget zu sichern. Mit einem flexiblen Teil von 15 % im Wirtschaftsplan soll zudem auf technische Neuerungen schnell reagiert werden können. Ziel ist es, die FITKO zu einer agileren und flexibleren Einheit zu entwickeln. Sie soll auch die Aufgabe erhalten, mehrjährige Projekte zu steuern. Zur Finanzierung des Digitalisierungsbudgets wird künftig ein einheitlicher Anteil des Bundes von 25 % festgeschrieben. Als Aufgabe des IT-Planungsrats soll zudem das föderale IT-Architekturmanagement implementiert werden.
Vertragspartner sind der Bund und die 16 deutschen Länder, Freistaaten und Freien Hansestädte. Nur wenn alle Parlamente zustimmen und sämtliche Ratifikationsurkunden bis spätestens zum 30. November 2024 bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der MPK eingegangen sind, tritt der Zweite Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags in Kraft. Andernfalls gilt der IT-Staatsvertrag in seiner aktuellen Fassung weiter. Vorausgesetzt, die Änderungen am IT-Staatsvertrag treten in Kraft, werden sie mit dem beschlossenen Zustimmungsgesetz des Landtags zugleich in Thüringer Landesrecht transformiert.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für das Jahr 2024 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRKwErstG 2024; Drucksache 7/9423)
Das Land erstattet den Kommunen auch für das Jahr 2024 Mehrkosten für ukrainische Kriegsflüchtlinge
Das Land erstattet den Kommunen auch für das Jahr 2024 Mehrkosten für hilfsbedürftige Flüchtlinge aus der Ukraine. Das hat der Thüringer Landtag beschlossen. Die Mehrkosten entstehen, weil diese Kriegsflüchtlinge seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes und weiterer Gesetze vom 23. Mai 2022 (BGBl. S. 760) keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr erhalten, sondern nach dem Zweiten, Neunten bzw. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Rechtskreiswechsel).
Dieser sog. Rechtskreiswechsel ist für die verschiedenen kommunalen Träger mit Mehrbelastungen verbunden, die der Freistaat nun auch über das Jahr 2023 hinaus ausgleicht. Hierzu werden die von Bund und Land bereitgestellten Mittel an die kommunalen Träger weitergeleitet, um damit bspw. die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, die kommunalen Eingliederungsleistungen, Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und Kosten für ärztliche Behandlungen oder Pflege zu finanzieren. Die jeweiligen Zuschussbedarfe werden zu 100 Prozent erstattet.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Januar / Februar 2024
Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (Drucksache 7/9186)
Aktuelle Weiterentwicklung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora gesetzlich nachvollzogen und angepasst
Der Landtag hat das Gesetz über die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora nach über 20 Jahren entsprechend den Entwicklungen der vergangenen Jahre aktualisiert.
Die Stiftung wird Träger des im Entstehen begriffenen Museums „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ in Weimar und der Stiftungszweck entsprechend erweitert. Die wissenschaftliche Beratung von Einrichtungen und Initiativen, „die in Thüringen die Verbrechen des Nationalsozialismus erforschen, dokumentieren und dazu historisch-politische Bildungsarbeit leisten“ gehört nun zu den gesetzlichen Aufgaben der Stiftung. Damit vollzieht der Landtag die gängige Praxis nach.
Außerdem hat der Landtag den Stiftungsrat um einen Sitz erweitert. Der sechste Vertreter ist für die zweite große Opfergruppe rassistischer Verfolgung im Nationalsozialismus neben den jüdischen Opfern vorgesehen, die Sinti und Roma. Erstmals hat der Landtag Kriterien für die persönliche Eignung der Mitglieder im Stiftungsrat definiert. Sie sollen unter anderem den Stiftungszweck unterstützen und aktiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung und die Unteilbarkeit der Menschenrechte eintreten.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Gesetz zur Änderung der Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (Drucksache 7/8909)
Feuerwehrrente künftig generell als Einmalzahlung möglich und Land für Aufbau eines landesweiten einheitlichen Alarmierungsnetzes zuständig
Ehrenamtliche Angehörige der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr können die für sie angesparte sogenannte Feuerwehrrente künftig generell als Einmalzahlung erhalten, wenn sie dies statt einer monatlichen Auszahlung wünschen. Das ist ein wesentlicher Teil der vom Landtag beschlossen Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (ThürBKG).
Bisher konnte die zusätzliche Altersversorgung nur als Einmalzahlung bezogen werden, wenn das Land und die kommunalen Aufgabenträger weniger als 15 Jahre für die personenbezogene Feuerwehrrente eingezahlt haben. Die Feuerwehrrente ist zum 1. Januar 2010 eingeführt worden. Es gab daher Befürchtungen, dass Angehörige der Einsatzabteilungen vorzeitig aus dem aktiven Dienst scheiden könnten, um die bisher geltende 15-Jahres-Schwelle nicht zu überschreiten und damit ihren Anspruch auf eine Einmalzahlung nicht zu verlieren. Die zeitliche Grenze wurde daher aus dem ThürBKG gestrichen.
Eine weitere Änderung des Gesetzes betrifft die Zuständigkeit für das landesweite Alarmierungsnetz. Das Land erhält damit jene Zuständigkeiten, die erforderlich sind, um ein landesweites einheitliches und dem aktuellen Stand der Technik entsprechendes digitales Alarmierungsnetz aufzubauen. Bisher waren die kommunalen Aufgabenträger im eigenen Wirkungskreis für das Alarmierungsfunknetz zuständig. Der Aufbau eines effizienten thüringenweiten Alarmierungsnetzes nach einheitlichen Standards war nach Meinung der Mehrheit im Landtag unter diesen Umständen kaum möglich.
Alle Dokumente und Informationen zum parlamentarischen Ablauf finden Sie hier.
Download
- Flyer Gesetzgebungsverfahren
PDF 5,59 MB - ist nicht barrierefrei

